Forum Wissenschaftskommunikation DIGITAL#fwk20 im virtuellen Raum
Talk-Runde zum AuftaktEinmischen erwünscht!?Wissenschaftskommunikation und Politik
Interview mit Carel Mohn „Verschwendet nicht zu viel Zeit auf die Leugner*innen“ von Sina Metz, Wissenschaft im Dialog
Interview mit Carel Mohn „Verschwendet nicht zu viel Zeit auf die Leugner*innen“ von Sina Metz, Wissenschaft im Dialog

Herr Mohn, der Titel der Session lautet „Ungleiche Schwestern“. Was unterscheidet die Corona- von der Klimakrise?
Die Struktur der Probleme ist sehr unterschiedlich. Auch wenn uns das anders vorkommt: Die Corona-Krise setzt an einem einzigen Punkt an, dem Immunsystem. Die Klimakrise wirkt dahingegen nicht nur auf das menschliche Immunsystem, sondern auf alles Leben auf der Erde und ist insofern viel komplexer. Der andere wichtige Unterschied ist, dass die Zeitskalen völlig andere sind. Die Coronavirus-Pandemie ist eine akute, unmittelbare Bedrohung. Die Folgen des Klimawandels sind langfristiger. Wobei dieses Wort langfristig uns dazu verleitet zu denken ‘Wir haben noch Zeit’.
Welche Auswirkungen hat das aus Ihrer Sicht auf die Kommunikation zu den beiden Krisen?
Die Corona-Pandemie ist eine sehr einschneidende Lernerfahrung für uns als Gesellschaft und auch global. Es ist wahrscheinlich in der Menschheitsgeschichte ein Novum, dass wir weltweit zeitgleich eine akute Krise erleben. Und das ist etwas, was uns verbindet. Darauf kann man Bezug nehmen. Es ist wichtig, diese Erfahrungen, die wir gemeinsam gemacht haben, jetzt zu reflektieren. Uns bewusst zu machen, was wir da eigentlich erlebt haben. Was lief gut? Welche Fehler haben wir gemacht? Wie haben wir darauf reagiert und was können wir daraus lernen, um andere Krisen vielleicht besser bewältigen zu können?
Und welche Lehren können wir aus der Corona-Krise für die Klima-Kommunikation ziehen?
Wir alle erleben direkt das Zusammenspiel zwischen politischen Entscheidungen und wissenschaftlicher Beratung und Expertise. Wir haben uns mit Corona anschauen können, was es unter den Realbedingungen einer Krise bedeutet, dass Wissenschaft und Politik zwar getrennte Aufgabenbereiche sind, aber dass zwischen beiden ein Wechselspiel bestehen sollte. Und wir haben gesehen: Wenn dieses Wechselspiel gut funktioniert, ist das auch im öffentlichen Interesse und trägt zum Gemeinwohl bei.Der Klimawandel, aber auch Themen wie Biodiversität oder der Umgang mit knappen Ressourcen wie Boden oder Wasser, stellen uns vor riesige Herausforderungen. Die Corona-Krise hat gezeigt, dass Menschen bereit sind, sich zu ändern und sich schnell an Neues anpassen können, wenn die Gründe gut erklärt werden. Und das können wir jetzt für den Klimawandel mitnehmen. Wir haben das Geld und wir haben die Technologien, um nachhaltiger und klimaverträglicher arbeiten, produzieren und leben zu können.Eine weitere Lernerfahrung aus der Corona-Krise ist meines Erachtens auch, wie wichtig es ist, über Werte zu sprechen. Bei Corona ging es um das Miteinander, um Solidarität. Und das hat geholfen, den richtigen Kurs zu finden. Ich glaube, wir brauchen auch in der Klimadebatte ein bisschen mehr Mut – gerade von Wissenschaftler*innen – über Werte zu sprechen, die uns einen Kompass liefern können.
Sie sprachen gerade die Fehlerkultur an. Zu Anfang der Corona-Krise war das Vertrauen der Bevölkerung in die Wissenschaft sehr hoch, viele fühlten sich gut informiert. Mittlerweile scheint die Stimmung zu kippen und es gibt massenhaft Demonstrationen gegen die Maßnahmen. Liegt das auch an Fehlern in der Kommunikation?
Ich glaube, Fehler sind unvermeidlich, und man muss sie machen, um daraus lernen zu können. Insgesamt ist das etwas, was die Corona- und die Klimakrise verbindet. Allerdings haben wir sowohl beim Thema Klimawandel als auch bei Corona die Tendenz, zu stark auf die extremen Ränder zu schauen, wie aktuell auf die Corona-Demonstrant*innen in Berlin oder Stuttgart und an anderen Orten. Es liegt in unserer Natur, uns für Extreme stärker zu interessieren als für das Normale. Aber das ist nicht immer geeignet, um ein vollständiges und zutreffendes Bild der Realität zu bekommen. Und ich glaube, zu diesem vollständigen Bild der Realität gehört auch, dass doch die meisten Menschen sehr vernünftig auf diese Krise reagiert haben. Wir haben eine beachtliche Anpassungsfähigkeit, sowohl als Individuen als auch als Gesellschaft. Ein sehr hoher Anteil der Menschen ist bereit, ihren Teil zur Krisenbewältigung beizutragen. Das darf nicht aus dem Blickfeld geraten.So spannend es auch ist, sich mit Verschwörungsideologien zu beschäftigen und zu versuchen zu verstehen, was diese Menschen antreibt, sie sind eben nur ein kleiner Ausschnitt. Ich würde sagen ‘Verschwendet bitte nicht zu viel Zeit auf die Leugner*innen’. Schaut auf die Menschen, die bereit sind mitzugehen, und erklärt auch immer wieder, wie Wissenschaft funktioniert. Die Corona-Krise hat gezeigt, dass gute Kommunikator*innen diejenigen sind, die uns den aktuellen Wissensstand erklären, und die auch von sich aus thematisieren, was wir bisher falsch eingeschätzt haben und wo wir dazulernen.
Aber dennoch sind die Corona- wie auch häufig die Klimawandel- Leugner*innen aktuell sehr laut. Wie geht man in der Kommunikation mit solchen Menschen um?
Gelassenheit hilft. Es ist wichtig, zu akzeptieren, dass es Leugner*innen gibt. Diese Reaktanz kann ein psychisches Muster sein, mit der ein Individuum meint, sich gegenüber einem äußerlichen Erwartungsdruck behaupten zu müssen. Wenn Normen wie zum Beispiel Abstands- und Hygieneregeln, aber auch Verhaltensregeln im Hinblick auf Klimaschutz sehr, sehr eindringlich und mit moralischen Werten verknüpft kommuniziert werden, fühlen sich manche Leute bedrängt und sagen ‘Jetzt erst recht nicht’. Der Schriftsteller Elias Canetti sprach von einem Stachel, den ein Befehl auslöst, und der sich wie ein Widerhaken bei einigen Menschen festsetzen kann. Das muss man erst einmal verstehen und auch akzeptieren, um mit Leugner*innen umzugehen.Die sozialwissenschaftliche Forschung zeigt übrigens, dass es eine wirksame Strategie ist, zu vermitteln, welche Mechanismen bei Verschwörungsideologien greifen. Falschaussagen, Propaganda, Lügen und Verdrehungen überschwemmen den Kommunikationsmarkt. Es hilft, Menschen dosiert mit Elementen solcher Falschbehauptungen bekannt zu machen. Wir versuchen das selbst auch bei klimafakten.de. Vor kurzem haben wir eine Infografik veröffentlicht, die die fünf populärsten Methoden von Propaganda und Falschinformationen analysiert und benennt. Das ist aus unserer Sicht ein wichtiges Element in einer Gegenstrategie.
Was möchten Sie in der Session beim Forum Wissenschaftskommunikation mit den anderen Referent*innen und dem Publikum diskutieren?
Die Corona-Krise ist eine sehr tief einschneidende gemeinsame Erfahrung und bietet durchaus auch Chancen, als Gesellschaft zu lernen. Wir müssen intensiv drüber reden, wo wir gemeinsam ansetzen können, wie verschiedene Akteure ihr Handeln bündeln können und was das für die Zukunft der Wissenschaftskommunikation bedeutet.In der Session möchte ich mich mit Marie-Luise Beck vom Deutschen Klima Konsortium, Dr. Stefanie Trümper vom K3-Kongress für Klimakommunikation und Karsten Schwanke, Meteorologe der ARD, darüber austauschen. Sie alle haben viel Fachkompetenz und Erfahrung und stehen für jeweils unterschiedliche Perspektiven. Das Deutsche Klima Konsortium repräsentiert als Dachverband der Klimaforschung die gesamte Szene. Stefanie Trümper ist jemand, die sich seit Jahren sozialwissenschaftlich mit den Mechanismen der Klima-Kommunikation beschäftigt. Und Karsten Schwanke präsentiert täglich die angewandte Wissenschaft in Alltagsform. Ich glaube, dass dieser Mix aus Zugängen und Kompetenzen zu einer guten Diskussion beiträgt.
Session
Ungleiche Schwestern: Corona und die Klimakrise
Seit klimafakten.de 2011 an den Start ging, leitet der Politologe und gelernte Journalist Carel Mohn das Projekt. Daneben ist er Programmdirektor beim Clean Energy Wire CLEW.
There is no glory in prevention Was die Wissenschaft aus der Corona-Pandemie mitnimmt von Sabine Hoscislawski, Wissenschaft im Dialog
There is no glory in prevention Was die Wissenschaft aus der Corona-Pandemie mitnimmt von Sabine Hoscislawski, Wissenschaft im Dialog

Dirk Brockmann vom Robert Koch Institut betrachtet das Virus aus epidemiologischer Sicht: Ausschlaggebend dafür, dass sich das Virus so schnell ausbreiten konnte, sei der Flugverkehr in der globalisierten und vernetzten Welt gewesen. Die Mobilität der Menschen zieht er für die Prognosen zum Infektionsgeschehen in Deutschland heran: Anhand von Bewegungsprofilen, die aggregierte und anonymisierte Handydaten der Bevölkerung ergeben, kann er Rückschlüsse ziehen, wie sich das Virus ausbreitet.
Während die naturwissenschaftliche Perspektive sich vor allem auf die Eindämmung des Virus konzentriert, stellt die Gesundheitspsychologin Sonia Lippke von der Jacobs University Bremen das Wohlbefinden des Individuums ins Zentrum. Die Weleda Trendforschung 2020 zeige, dass sich die Menschen weit weniger um eine Ansteckung mit dem Virus (32 Prozent) als um ihre Zukunft (44 Prozent) sowie ihre Familie und Freunde (45 Prozent) sorgen. „Das muss einfach berücksichtigt werden bei der Kommunikation von Maßnahmen und dem ganzen Infektionsgeschehen“, erklärt sie. Interessant sei außerdem, dass 33 Prozent der Befragten Angst haben, ihre Freiheitsrechte zu verlieren.
Natur- und Rechtswissenschaften: eine (un)mögliche Symbiose?
Die Abwägung zwischen Gesundheitsschutz und Eingriffen in die Freiheitsgrundrechte ist auch für den Staatsrechtler und ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts Hans-Jürgen Papier zentral. Es müsse geklärt werden, ob die ergriffenen politischen Maßnahmen im Verhältnis zu den Gefahren angemessen gewesen seien. Dabei seien natürlich naturwissenschaftliche Erkenntnisse zu berücksichtigen. Dennoch könne die Wissenschaft nur Prognosen liefern, entscheiden müssten die vom Rechtsstaat legitimierten Organe.
Papier kritisiert, dass einschneidende Maßnahmen ohne die Legitimation des Parlaments beschlossen worden seien. Viele Menschen hätten hohe Opfer bringen müssen, ohne dass der Gesetzgeber eine Entschädigungsregelung treffe. Denn das bestehende Infektionsschutzgesetz entschädigt nur Erkrankte und Ansteckungsverdächtige, die Maßnahmen seit März setzten aber die Gesamtbevölkerung einem „Generalverdacht“ aus, epidemiologisch gefährlich zu sein, urteilt Papier.
Doch wie könne die rechtliche Perspektive in den naturwissenschaftlichen Modellen mitgedacht werden, fragt Naturwissenschaftler Brockmann, wenn die Kontakte zwischen Menschen entscheidend für die Modellierung von Epidemien seien? Dies bleiben theoretische Überlegungen. In der Session kann nicht geklärt werden, wie sich der Konflikt zwischen Freiheitsrecht und Gefahrenfaktor mathematisch darstellen lassen könnte.
Mehr Transdisziplinarität
Vielleicht kann ein offener Zugang zum Thema, über Disziplingrenzen hinweg, helfen. Brockmann plädiert für mehr Transdisziplinarität: „Wir haben es bei Corona mit etwas Transdisziplinärem, fast Antidisziplinären, zu tun.“ Bei Treffen mit Expert*innen aus verschiedenen Disziplinen habe er gemerkt, dass diese das Gesamtphänomen oft nur aus ihrer eigenen Fachrichtung heraus betrachten würden, sagt Brockmann. Das verzerre den Blick auf das große Ganze. Wichtig sei zu verstehen, was die anderen machen, schließlich seien Infektionsgeschehen, Verhalten und psychologische Prozesse miteinander verwoben.
Bessere Kommunikation ist aber nicht nur über wissenschaftliche Disziplingrenzen hinweg nötig. Auch zwischen Wissenschaft und Medien müsse präziser kommuniziert werden, findet Gesundheitspsychologin Lippke. In der Pandemie sei von der Presse beispielsweise der Begriff der sozialen Distanzierung fälschlicherweise mit der körperlichen Distanzierung gleichgesetzt worden – fatal, da sich jetzt doppelt so viele Menschen wie vor Corona einsam fühlten, aber nur das physische Abstandhalten vor einer Ansteckung und damit Ausbreitung des Virus helfe.
Es gelte sich klarzumachen, dass die Bevölkerung in einer solchen Situation Ängste habe, sagt Lippke. Mit abstrakten Zahlen wie Wahrscheinlichkeitsangaben könne man die Menschen nicht abholen, schlimmstenfalls würden sie sich dann ihre Antworten in anderen Foren suchen und bei Verschwörungsideologien landen. Wichtig sei es, partizipatorisch zu denken, und zu überlegen, was die Menschen wirklich brauchen.
Session
There is no glory in prevention – Vertrauen in Wissenschaft, Risikobewusstsein und Grundrechte
Prof. Dr. Dirk Brockmann leitet die Forschungsgruppe Epidemiologische Modellierung von Infektionskrankheiten am Robert Koch-Institut. Er ist Professor am Institut für Biologie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Prof. Dr. Sonia Lippke hat den Lehrstuhl für Gesundheitspsychologie und Verhaltensmedizin an der Jacobs University Bremen inne und ist Faculty in der Bremen International Graduate School of Social Sciences (BIGSSS). Prof. em. Dr. Hans-Jürgen Papier lehrt Öffentliches Recht an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Von 2002 bis 2010 war er Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Christoph Koch ist Leitender Redakteur (Wissenschaft) beim Wochenmagazin Stern.
Graphic RecordingsDas waren die Projektvorstellungen beim #fwk20 DIGITAL
wissenschaftskommunikation.deThemenschwerpunkt Wissenschaft & Politik
Nichts für die Schublade! Erst denken, dann handeln von Dorothee Menhart, Wissenschaft im Dialog
Nichts für die Schublade! Erst denken, dann handeln von Dorothee Menhart, Wissenschaft im Dialog

Analyse – Strategie – Maßnahmenplanung
Was umfasst ein gutes Kommunikationskonzept eigentlich und wie geht man sinnvollerweise vor? Nadine Lux und Gabriele Schönherr von science³ stellen die wichtigsten Schritte vor: Analyse, Strategie und Maßnahmenplanung. Dabei betonen sie die Reihenfolge, denn natürlich baut alles aufeinander auf. Bei der Analyse der Ausgangslage seien Beteiligungsprozesse wichtig, das Anhören von Kolleg*innen verschiedenster Hierarchieebenen, von Teamkolleg*innen bis zu Stakeholdern und Entscheider*innen, um sich ein klares Bild vom Kommunikationsumfeld und den bestehenden Möglichkeiten der eigenen Organisation oder des geplanten Projekts zu verschaffen. In einem zweiten Schritt folgt die Strategieentwicklung. Welche Zielgruppen sollen in den Blick genommen werden? Welche Kommunikationsziele werden verfolgt und welche davon sind die wichtigsten? Wer klare Ziele und Botschaften benennen kann, tut sich im dritten Schritt leichter, sinnvolle Maßnahmen zur Erreichung der gesteckten Ziele festzulegen. Teil der Maßnahmenplanung sind selbstverständlich nicht nur Kommunikationsmaßnahmen, sondern auch ein Zeitplan, ein Ressourcenplan sowie die Erfolgsmessung.
Julia Crispin und Cornelia Lossau von der Deutschen Forschungsgemeinschaft haben gemeinsam mit der Agentur science³ ein Kommunikationskonzept für ein DFG-Projekt zum Digitalen Wandel erarbeitet. Ein Dreivierteljahr lang wurden in Workshops Strategie- und Maßnahmenskizzen erarbeitet, Senatsmitglieder und Vizepräsident*innen befragt und wurde am Konzept gefeilt. Von der ersten Projektidee bis zum fertigen Konzept dauerte der gesamte Prozess jedoch fast zweieinhalb Jahre. Denn erst nachdem das eigene Haus überzeugt war, konnte die Ausschreibung für eine externe Agentur starten.
Der Aufwand für ein umfassendes Konzept – auch mit Hilfe von Kommunikationsberater*innen – ist hoch. Doch die Referentinnen wie auch viele Teilnehmende sind sich völlig einig, dass er sich lohnt: Weil eine Stimme von außen oft besser gehört werde als die eigene und sinnvolle Ideen damit leichter durchsetzbar seien. Weil unsinnige Ideen, die aus höheren Hierarchieebenen manchmal auf einen einprasseln, mithilfe eines guten Kommunikationskonzepts leichter abgeschmettert werden können. Weil die Einbindung von Stakeholdern und Entscheider*innen in der Analysephase das Verständnis für die eigene Arbeit fördert und manchmal auch zu der Einsicht führen kann, dass für bestimmte Aufgaben beispielsweise eine zusätzliche Stelle geschaffen werden muss. Und nicht zuletzt: Weil sehr viel Geld sparen kann, wer sorgfältig konzipiert und sich deshalb nicht so leicht teure Vorhaben ans Bein binden lässt.
Der Tipp: Wenigstens kurz innehalten
Eine kleine Mentimeter-Umfrage zu Beginn des Workshops hat gezeigt: Zwar gibt es in vielen Einrichtungen ein Leitbild oder Kommunikationsstrategien für einzelne Themen oder Projekte. Von 18 Antwortenden haben zwölf jedoch noch nie ein Kommunikationskonzept erstellt oder genutzt.
Die vier Referentinnen ermuntern nachdrücklich dazu. Als ersten Anfang schlagen sie vor, für eine halbe Stunde einmal den Wahnsinn des operativen Geschäfts beiseite zu schieben, sich hinzusetzen und auf einer halben Seite festzuhalten: Wo stehen wir? Wo wollen wir hin? Und was könnten die ersten Schritte sein? Allein wer sich diese Fragen stelle, schärfe den Blick auf die eigene Organisation oder ein geplantes Projekt. Und selbst, wenn ein Konzept am Ende doch einmal in der Schublade lande, so profitiere man in der Kommunikationsarbeit davon: Man sei schlicht besser gerüstet für das, was kommt.
Workshop
Nichts für die Schublade! Kommunikationskonzepte in Theorie & Praxis
Dr. Julia Crispin arbeitet als Referentin in der Gruppe Wissenschaftliche Literaturversorgungs- und Informationssysteme der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). Cornelia Lossau ist bei der DFG Direktorin in der Gruppe Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Nadine Lux und Dr. Gabriele Schönherr sind Geschäftsführende Gesellschafterinnen bei science3, einer Agentur, die insbesondere wissenschaftsnahen Einrichtungen Unterstützung im Kommunikationsmanagement bietet.
Interview mit Dr. Julia Gantenberg „Vielleicht wäre es besser, von Vorläufigkeit zu sprechen“ von Sabine Hoscislawski, Wissenschaft im Dialog
Interview mit Dr. Julia Gantenberg „Vielleicht wäre es besser, von Vorläufigkeit zu sprechen“ von Sabine Hoscislawski, Wissenschaft im Dialog

Was bedeutet Unsicherheit in der Wissenschaft?
Wissenschaft liefert Ergebnisse unter dem Vorbehalt von Vorläufigkeit und Unsicherheit. Fast jeder Gegenstand kann aus verschiedenen Perspektiven untersucht, empirische Befunde unterschiedlich interpretiert werden. Damit ist Unsicherheit als solche unabdingbarer Bestandteil des wissenschaftlichen Erkenntnisgewinns. Der Kommunikation von sicherem Wissen sind dadurch Grenzen gesetzt.
Welche positive Wirkung hat die offene Kommunikation von Unsicherheit?
Wenn die Unsicherheit immer wieder als etwas ganz Normales dargestellt wird, werden Wissenschaft und ihre Funktionsweise besser verstanden. Dadurch werden nicht nur wissenschaftliche Ergebnisse besser eingeordnet, sondern auch das Vertrauen ins wissenschaftliche Arbeiten wird gestärkt und legitimiert.
Was sind Gefahren dieser Offenheit?
Politik, Medien und Öffentlichkeit wollen von der Wissenschaft Orientierung und direkte Handlungsempfehlungen. Der Hinweis, dass Erkenntnisse vorläufig sind, kann dabei irritieren. Schlimmstenfalls wird das Vertrauen in die Wissenschaft geschwächt. Genau das sehen wir in der Corona-Pandemie: Die „etablierte“ Wissenschaft wird in Frage gestellt. Wissen, das nicht den wissenschaftlichen Kriterien entspricht, wird als gleichwertig oder sogar sicherer erachtet.
Wie sollte die Wissenschaftskommunikation damit umgehen?
Wir sollten diesen Anspruch „von außen“ immer mitdenken und stets verdeutlichen, welche Art von Wissen möglich ist. Die Wissenschaft kann die Politik beraten, aber nicht für sie entscheiden. Wichtig ist auch, dass wir uns die eigene Rolle noch klarer machen. Wenn wir zum Beispiel von Medien angefragt werden, ein Thema zu kommentieren, müssen wir uns fragen, ob das wirklich unser Forschungsgebiet ist. Wissenschaftler*innen sollten sich auch die Freiheit nehmen, offen zu sagen, wenn sie zu einem Aspekt keine stichhaltige Aussage machen können.
Bedeutet offene Kommunikation, dass die Wissenschaftscommunity jedes Detail in den öffentlichen Diskurs trägt?
Idealerweise sollten natürlich alle relevanten Informationen kommuniziert werden. Dazu gehört auch das Wissen um Wissenschaft und ihr theorie- und methodengeleitetes Arbeiten. Das funktioniert aber nicht in jeder Situation und in jedem Format. In einer Pressemitteilung ist dafür kein Platz, Wissenschaftsvideos wie maiLab zeigen hingegen, dass es funktionieren kann. Neben den wissenschaftlichen Inhalten wird dort erklärt, wie wir Studien interpretieren und was wir daraus folgern können.
Der Begriff „Unsicherheit“ hat eine negative Konnotation. Ist es möglich ihn positiv zu framen?
Meiner Meinung nach geht es nicht darum den Begriff anders zu framen. Die Unsicherheit sollte einfach als Komponente wissenschaftlichen Arbeitens anerkannt und selbstverständlich mitkommuniziert werden. So verliert der Begriff automatisch seine negative Konnotation. Vielleicht wäre es insgesamt besser, von „Vorläufigkeit“ zu sprechen.
Interaktives Format
Unsicherheit in der Wissenschaft – Gefahr oder Garant für den Vertrauenserhalt?
Dr. Julia Gantenberg ist Wissenschaftskommunikatorin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Arbeit und Politik der Universität Bremen (zap).
Bewährungsprobe Covid-19 Unsicherheiten kommunizieren lohnt sich von Dorothee Menhart, Wissenschaft im Dialog
Bewährungsprobe Covid-19 Unsicherheiten kommunizieren lohnt sich von Dorothee Menhart, Wissenschaft im Dialog

In der Session „Bewährungsprobe Covid-19“ kommen die Diskutierenden aus Wissenschaft, Medien und Kommunikation vor allem zu zwei Feststellungen. Einmal: Nicht jede Botschaft muss auf einen Tweet verkürzt werden, denn Politik und Gesellschaft haben in der Pandemie gezeigt, dass sie auch Komplizierteres vertragen. Und: Wissenschaftler*innen, die mit ihrer Expertise in die Öffentlichkeit gehen, tragen eine enorme Verantwortung.
„Eine eindeutige Einschätzung kann man nur abgeben, wenn die Lage eindeutig ist“
Zunächst zum vermeintlichen Zwang, alles zu verkürzen: Laut dem Epidemiologen und in den vergangenen Monaten sehr gefragten Interviewpartner Gérard Krause vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung, kann man eine klare und eindeutige Einschätzung nur abgeben, wenn die Lage klar und eindeutig ist. Im Falle der Pandemie sei das aber nicht der Fall und deshalb Differenzierung gefragt. Empfehlungen zu geben – auch bei gegebener Unsicherheit – sei zwar herausfordernd aber machbar. Problematisch werde es für Wissenschaftler*innen, wenn sie so sehr verkürzen sollten, dass sie sich mit ihren Aussagen nah am Falschen bewegten bzw. aufgrund mangelnder Differenzierung Gefahr liefen, falsch verstanden zu werden. Damit umzugehen, sei die eigentliche Herausforderung, sagt Krause. „Die Welt ist nicht so einfach, dass sie in einen Tweet passt.“
Der Wissenschaftsjournalist Rainer Kurlemann hat in den vergangenen Wochen beobachtet, dass viele Menschen durchaus bereit sind, sich in komplizierte Sachverhalte einzuarbeiten oder sich diese erklären zu lassen. Wie sich Kurven entwickeln, was eine exponentielle Steigerung ist – sowas erschien vielen Journalist*innen und Kommunikator*innen bislang als zu kompliziert für die Leserschaft, so Kurlemann. Nach den ersten Pandemie-Monaten aber ist er überzeugt: „Wir sollten mutig sein und keine Angst davor haben, nicht verstanden zu werden. Wenn es nötig ist, dass die Menschen einen komplizierten Sachverhalt verstehen, um eine politische Entscheidung nachvollziehen zu können, dann müssen wir erklären.“
Durchaus ernst zu nehmen: Die Rollenverteilung zwischen Wissenschaft und Politik
Dem stimmt auch die Kommunikatorin Julia Wandt zu: Auch sie hat eine große Bereitschaft zu Tiefgang und Länge beobachtet, vermutet aber, dass dies auch durch die persönliche Betroffenheit durch Corona befördert wurde. Wandt lenkt die Diskussion auf einen weiteren Punkt, der ihr in den vergangenen Monaten aufgefallen ist: Einige wenige Expert*innen hätten die Rollenverteilung zwischen Wissenschaft und Politik nicht immer klar beherzigt. So seien einige gemeinsam mit Politikern aufgetreten und hätten suggeriert, Teil der Entscheider zu sein, obwohl sie als Forschende lediglich Empfehlungen an die Politik abgeben könnten, die Verantwortung für politische Entscheidungen zur Eindämmung der Pandemie aber einzig und allein bei der Politik liege.
Auch wenn darüber Einigkeit herrscht, sieht Gérard Krause eine enorme Verantwortung auch auf Seiten der kommunizierenden Wissenschaftler*innen: Sie dürften nur Aussagen treffen, die wirklich gut belegt sind. Unsicherheiten sollten am besten direkt mitkommuniziert werden. Dann komme man auch nicht so leicht in die verzwickte Lage sagen zu müssen, dass die Sachlage sich verändert habe und nun andere Konsequenzen zu empfehlen seien. Denn besser, als veränderte Sachlagen eingestehen zu müssen, sei in jedem Fall: Von vornherein klar sagen, was sicher bekannt ist und welche Fragen offen sind.
Durch Kommunikation von Unsicherheiten dem Boulevard den Wind aus den Segeln nehmen
Moderator Josef Zens ist damit sehr einverstanden. Weil er das Geschäft des Journalismus kennt, gibt er aber zu bedenken, dass Wissenschaftler, die derart vorgehen, womöglich von Journalisten nicht gern gehört werden, weil sich Eindeutigkeiten schlicht besser verkaufen lassen. Rainer Kurlemann sieht das ebenfalls als Problem. Deshalb habe die Corona-Krise gezeigt, wie wichtig guter Wissenschaftsjournalismus mit kompetenten Autor*innen sei. Er sieht aber auch eine besondere Verantwortung auf Seiten der Wissenschaftskommunikator*innen: Eigentlich müsse bereits jetzt klar kommuniziert werden, welche Unsicherheiten es beispielsweise im Zusammenhang mit Impfungen gegen Covid-19 gebe und dass es beispielsweise möglich sei, dass die Impfung keinen 100-prozentigen Schutz gewährleiste. „Wenn das in der seriösen Berichterstattung versäumt wird, ist zu erwarten, dass die Boulevard-Zeitungen mit der Schlagzeile aufwarten, dass es keinen 100-prozentigen Impfschutz gibt und damit die Impfung diskreditieren“, warnt Kurlemann. Die Wissenschaftskommunikation müsse solche Unsicherheit proaktiv kommunizieren und nicht erst nach falschen Schlagzeilen und falschen Empfehlungen reagieren, ergänzt Kurlemann.
Julia Wandt sieht einen klaren Auftrag für die professionelle Wissenschaftskommunikation: In der Pandemie seien zwar Wissenschaftler*innen selbst die besten Kommunikator*innen. Aber die Profis in den Kommunikationsabteilungen müssten ihnen beratend zur Seite stehen und Empfehlungen abgeben, was wann wie kommuniziert werden sollte.
Session
Bewährungsprobe Covid-19 – Wenn Wissenschafts-PR unter politischen Druck gerät
Prof. Dr. Gérard Krause ist Lehrstuhlinhaber an der Medizinischen Hochschule Hannover und Leiter der Abteilung Epidemiologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig. Rainer Kurlemann ist Wissenschaftsjournalist und Gründer der Zukunftsreporter bei RiffReporter. Julia Wandt leitet die Kommunikationsabteilung der Universität Konstanz und ist Vorsitzende des Bundesverbands Hochschulkommunikation. Josef Zens leitet die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit am Deutschen GeoForschungsZentrum GFZ.
KeynoteExpertise erwünscht?!Wissenschaftsbasierte Politikberatung in der Corona-Krise
Graphic RecordingsDas waren die Projektvorstellungen aus Block 2
Recaps bei InstagramLive-Recaps des #fwk20 zum Nachschauen
Interview mit Dr. Stefanie Orphal „Wir müssen Daten und Zahlen verantwortungsvoll kommunizieren“ von Ursula Resch-Esser, Wissenschaft im Dialog
Interview mit Dr. Stefanie Orphal „Wir müssen Daten und Zahlen verantwortungsvoll kommunizieren“ von Ursula Resch-Esser, Wissenschaft im Dialog

Frau Orphal, wie ist die Idee zu Ihrer Session entstanden?
In einer Institution, die selbst Daten erhebt, legen wir schon länger ein Augenmerk darauf, wie wir Ergebnisse vermitteln. So sind wir auch mit unseren Wissenschaftler*innen im Gespräch darüber, was ihre Daten wirklich aussagen und was nicht. Wo kann man von Kausalität und wo von Veränderungen in den Daten sprechen. Bei der Erhebung von Daten stellt sich die Frage, wo kommen die Daten eigentlich her, was wird genau gezählt.Und dann kam Corona und hat uns gezeigt, dass es jetzt eine besondere Aufmerksamkeit für solche Fragen gibt. Corona hat sehr deutlich gemacht, dass auch Wissenschaftskommunikation, bei der Art und Weise wie Daten und Zahlen dargestellt und kommuniziert werden, eine große Verantwortung hat.
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Gilt das alte Sprichwort auch für Grafiken bei der Kommunikation zur Corona-Pandemie?
Ja! Es gab wahrscheinlich kaum ein eindrücklicheres Bild als das dieser Kurve, die wir am Anfang der Pandemie gesehen haben, dieses Bild zu „Flatten the Curve“.Es hat sich wie ein Symbol eingebrannt für das, was auf uns zukommen könnte und dafür, welche Möglichkeiten es gibt, gegen die Auswirkungen der Pandemie vorzugehen. Die ganze Vorgehensweise des Lockdowns wurde letztlich damit begründet.Gleichzeitig hat sich aber auch gezeigt, welchen Nachholbedarf es beim Verständnis all dieser Dinge gibt, die dann aufkamen: exponentielles Wachstum, logarithmische Skalen, die Darstellung der Zeitskalen, Sterblichkeitsraten, dass aber auch ein sehr breites Interesse daran herrschte. Wir haben gesehen, dass das Publikum das wirklich verstehen möchte. Wenn wir über Zahlen und Daten sprechen, gibt es für Kommunikator*innen noch viel zu tun.
Welche Möglichkeiten aber auch Gefahren liegen denn in der Darstellung, der Visualisierung von Daten?
Man muss sich immer fragen, erreiche ich mit der Grafik überhaupt einen Mehrwert. Und man muss transparent sein, zum Beispiel bei eingefärbten Karten, bei denen Länder verschiedene Farben haben, die bestimmte Werte symbolisieren. Da muss man sagen welche Abstufungen sind verwendet worden, wie bin ich vorgegangen, welche Vorentscheidungen sind schon getroffen worden. Zeige ich wirklich, was die Daten sagen, oder versuche ich, etwas anderes, vielleicht etwas Sensationelleres rauszuholen.
Es gibt also die Möglichkeit, dass man durch die Aufbereitung von Daten Ergebnisse sichtbar machen kann, aber auch, dass man dadurch Daten verfälschen kann?
Genau so meine ich das.Es gab neben Corona noch eine konkrete Inspiration für die Session. Das war das Buch „The Tiger that isn‘t“. Einer der Autoren, Andrew Dilnot, wird auch auf dem Podium sein. Er war auch Moderator der Sendung „More or less“ bei BBC Radio 4. Darin geht es, wie in dem Buch, um den Umgang mit Zahlen und Daten in den Medien und in der Politik. Politik beruft sich ja sehr oft auf Wissenschaft. Wir haben in der Corona-Krise gesehen, dass das Zusammenspiel zwischen beiden sehr komplex sein kann.Mich hat das Buch begeistert, weil es für einen verantwortungsvollen Umgang mit Daten und Zahlen sensibilisiert, mit ganz konkreten Beispielen die Darstellung von Daten kritisch hinterfragt, aber auch die Frage diskutiert, wie wir Unsicherheit kommunizieren. Es will den Leserinnen ein Werkzeug an die Hand geben, dass sie selbst weiter denken können im Sinne von Scientific Literacy – eben auch auf Zahlen und Daten bezogen. Und das ist genau das Ziel von Wissenschaftskommunikation.
Wen wollen Sie mit Ihrer Session besonders ansprechen?
Ich will Wissenschaftskommunikator*innen sowie Menschen aus den Kommunikationsabteilungen der wissenschaftlichen Institute ansprechen. Ich möchte sehr gerne einerseits ein Gefühl für diese Verantwortung vermitteln, was es bedeutet, über wissenschaftliche Zahlen zu kommunizieren, und eben auch welche Verlockungen es gibt bei der Interpretation und Darstellung.
Zu Ihrer Session haben Sie Vertreter verschiedener Disziplinen eingeladen, warum?
Für uns waren aufgrund unserer Herkunft erst einmal empirische und sozialwissenschaftliche Daten wichtig, dafür ist Gwendolin Sasse, die Direktorin des ZOiS mit dabei. Im Zusammenspiel mit der Politik sind aber auch ökonomische Daten wichtig. Auch darüber würde ich sehr gerne diskutieren, weil es gerade da besonders gesellschaftlich relevant ist, wenn die Zahlen auf eine Art und Weise dargestellt werden, die vielleicht verkürzend ist. Andrew Dilnot hat sich auch mit Gesundheitsdaten beschäftigt, so dass wir auch diesen Bereich abdecken. Außerdem ist Harald Wilkoszewski dabei, er ist Ökonom und Politikwissenschaftler und jetzt in der Wissenschaftskommunikation tätig. Wir haben also Leute auf dem Podium, die in beiden Bereichen, Wissenschaft und Wissenschaftskommunikation, zu Hause sind. Und da wir beim Forum ja bei einem Treffen von Fachleuten sind, hoffe ich, dass wir in der Session auch Erfahrungen der Teilnehmer*innen mit einbinden können.
Der Schwerpunkt des diesjährigen Forums lautet „Einmischen erwünscht!? Wissenschaftskommunikation und Politik“ Wie sehr kann und darf Wissenschaftskommunikation sich in Politik einmischen?
Als Kommunikatorin sehe ich es als Aufgabe, wissenschaftliche Ergebnisse da, wo sie relevant sind, auch prominent zu machen und zu vertreten. Es muss aber eine Grenze geben zur Politik, wobei die Politik mit der entsprechenden Legitimation die Entscheidungen treffen muss. Ich finde es steht Wissenschaftler*innen zu, aus wissenschaftlichen Ergebnissen eine Position abzuleiten. Und wenn die sehr gut begründet ist, mit der eigenen Forschung, dann kann man das auch mit der Wissenschaftskommunikation unterstützen. Es muss aber immer klar sein, in welcher Rolle man spricht.
Könnte man sagen, dass man mit Bildern, mit Grafiken, Politik machen kann?
Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen, mit Bildern und natürlich auch mit Zahlen.
Session
Data, curves, and interpretations: numerical literacy in research communication
Dr. Stefanie Orphal leitet den Bereich Kommunikation am Zentrum für Osteuropa- und internationale Studien (ZOiS).
Science communication during the corona pandemic Vertrauen in Wissenschaft und Forschung in Corona-Zeiten von Carla Romagna, Wissenschaft im Dialog
Science communication during the corona pandemic Vertrauen in Wissenschaft und Forschung in Corona-Zeiten von Carla Romagna, Wissenschaft im Dialog

Die Datenerhebungen fanden in allen Ländern in einem ähnlichen Zeitraum statt, mit einer vergleichbaren Stichprobengröße und einer analogen Vorgehensweise bei der Extrapolation auf die Gesamtbevölkerung. Natürlich gab es auch Unterschiede im Design der Studien, beispielsweise in der Methodik und bei den detaillierten Fragestellungen, erklärt Moderator Philipp Schrögel vom Karlsruher Institut für Technologie zu Beginn der Veranstaltung.
Social Media weniger relevant als angenommen
Schrögel beginnt die Session mit einer eigenen Umfrage. Das Ergebnis: Nach Einschätzung der Session-Teilnehmenden hat nicht nur das Vertrauen der Bevölkerung in die Wissenschaft während der Corona-Pandemie zugenommen, sondern auch die Relevanz von Social Media sei gestiegen. Ein interessantes Ergebnis, so Schrögel, denn alle Referent*innen werden später übereinstimmend berichten, dass laut den Umfragen in Schweden, Italien und Deutschland die Hauptquellen für die Informationsbeschaffung die traditionellen Medien, wie Fernsehen, Zeitungen und Radio waren, gefolgt von den Webseiten öffentlicher Behörden und Institutionen. Social Media wurden den Befragungsergebnissen zufolge tatsächlich nur zu einem sehr geringen Prozentsatz genutzt, um Informationen bezüglich der Corona-Krise und der Forschung dazu zu erhalten.
Vertrauen in verschiedene Akteursgruppen
Beim Vertrauen der Bevölkerung bezüglich Aussagen zu Corona und Aktivitäten zur Bekämpfung der Pandemie lassen sich Unterschiede für verschiedene Akteursgruppen beobachten: Vor allem in Schweden und Deutschland scheinen Ärzt*innen ein besonders großes Vertrauen zu genießen, gefolgt von Wissenschaftler*innen und Mitgliedern von Regierung und lokalen Institutionen. In Schweden sei das Vertrauen in Politiker*innen und Journalist*innen zwar gering, erläutert Gustav Bohlin, jedoch sei diese Haltung in Bezug auf Journalist*innen schon in vielen früheren, nationalen Umfragen beobachtet worden.
In Italien, erklärt Barbara Saracino, vertraue man beispielsweise den Zeitungsartikeln wenig, wenn es um Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie gehe, jedoch glaube man in diesem Punkt besonders den lokalen Institutionen. Ein besorgniserregendes Ergebnis ist aus Sicht des Publikums, dass in Italien eine große Mehrheit den Umgang der Europäischen Union mit der Corona-Krise als negativ bewertet hat. Grund dafür dürfte deren mangelnde Unterstützung bei der Krisenbewältigung und der Koordination zwischen den Ländern sein. Das sei eine wichtige Erkenntnis, meint auch Barbara Saracino.
Hohe Wertschätzung der Wissenschaft während der Corona-Krise
In Italien, erklärt Barbara Saracino, ist die große Mehrheit der Bevölkerung der Meinung, dass Wissenschaftler*innen eine Lösung bezüglich der Corona-Pandemie finden werden. Jedoch befindet die Hälfte der Italiener*innen, dass sich die Expert*innen, die in den vergangenen Monaten zu Wort kamen, oft uneins waren und somit für Verwirrung sorgten.
In Deutschland sei das Vertrauen in die Wissenschaft im Vergleich zu 2019 gestiegen, berichtet Ricarda Ziegler. Rund 80 Prozent der Befragten des Wissenschaftsbarometers wünschten sich, dass politische Entscheidungen zum Umgang mit Corona auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren. Ähnlich wie in Italien finden etwa 50 Prozent der Deutschen zudem, dass die Forschenden, die öffentlich zu Corona kommunizieren, gut zwischen gesichertem Wissen und noch offenen Forschungsfragen unterscheiden.
Auf Nachfrage des Publikums, wie es denn mit den Wissenschaftssurveys weitergehe, bekräftigen die Referent*innen die Absicht, die bereits bestehende Zusammenarbeit auch künftig fortzuführen und zu intensivieren. Auch wenn bisher individuell entwickelte Methoden und Schwerpunkte ihren Sinn haben, wäre die Entwicklung gemeinsamer Standards eine interessante Perspektive. Angesichts des Verlaufs der Corona-Pandemie im Sommer und Herbst 2020 bleibt die Veränderung der öffentlichen Wahrnehmung von Wissenschaft und Forschung durch die Pandemie ein relevantes Thema. Die anstehende weitere Ausgabe des deutschen Wissenschaftsbarometers – voraussichtlich im Dezember 2020 – wird darüber Auskunft geben.
Session
Science communication during the corona pandemic – public perceptions in three European countries
Gustav Bohlin ist Wissenschaftler bei Vetenskap & Allmänhet (Wissenschaft & Öffentlichkeit) und beteiligt am VA Barometer. Barbara Saracino ist Wissenschaftlerin an der Università di Bologna im Fachbereich Politik- und Sozialwissenschaften, Mitglied des Lenkungsausschusses von Observa Science In Society und Koordinatorin des Science in Society Monitor. Ricarda Ziegler ist Projektleiterin Wissenschaftsbarometer bei Wissenschaft im Dialog. Philipp Schrögel ist Wissenschaftler am Karlsruher Institut für Technologie.
Graphic RecordingsDas waren die Projektvorstellungen aus Block 3
VolkswagenStiftung: Was wirkt? Vorsicht vor einfachen Schlussfolgerungen von Sabine Hoscislawski, Wissenschaft im Dialog
VolkswagenStiftung: Was wirkt? Vorsicht vor einfachen Schlussfolgerungen von Sabine Hoscislawski, Wissenschaft im Dialog

Wissenschaftsvertrauen in der Pandemie und darüber hinaus
Ricarda Ziegler, Projektleiterin des Wissenschaftsbarometers bei Wissenschaft im Dialog, ordnet zu Beginn der Session die Ergebnisse des Wissenschaftsbarometers Corona Spezial ein: Generell passe das hohe Vertrauen zu dem in Deutschland vergleichsweise positiven Bild von Wissenschaft. Interessant sei außerdem, dass der Anstieg des Vertrauens in Wissenschaft und Forschung mit einer Abnahme der Zahl der Unentschiedenen einherging. Der recht geringe Anteil der Misstrauenden sei hingegen stabil geblieben. Dazu passe auch, dass ein Großteil der Befragten im Frühjahr fand, dass Wissenschaftler*innen gut kommuniziert und zwischen sicherem Wissen und offenen Fragen zu Corona unterschieden hatten. Abzuwarten bleibe, wie die Zustimmungswerte im Spätjahr 2020 aussehen. Ziegler schränkt außerdem ein: „Bei der Frage, welche Bereiche der Wissenschaft die Menschen im Kopf haben, dominieren dieses Jahr noch stärker Nennungen rund um den medizinischen Gesundheitsbereich. Da sind Themen und Bereiche dabei, die wir gar nicht als Wissenschaft und Forschung verstehen würden.“
Wie stark die politisch-gesellschaftliche Diskussion über spezifische Themen das Vertrauen in die Wissenschaft bestimmt, hebt auch Rainer Bromme, Senior-Professor für Pädagogische Psychologie an der Universität Münster, hervor: „Ich vermute, dass die gleiche Umfrage im Kontext von Klimawandel keinen so starken Anstieg im Vertrauen verzeichnen würde.“ Es liege daher nicht allein in der Macht von Wissenschaftskommunikator*innen, das Vertrauen zu beeinflussen, schlussfolgert er.
Rationalität als Basis
Ernst Dieter Rossmann, Vorsitzender des Bundestagsausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung, warnt davor, aus dem aktuell hohen Vertrauenswert voreilige Schlüsse zu ziehen: „Was bleibt denn den Menschen momentan anderes, als darauf zu hoffen, dass die Wissenschaft ein Gegenmittel findet und alles richtig macht? Die Bewährung des Vertrauens in die Wissenschaft kommt erst, wenn es noch zwei oder drei Jahre dauern sollte.“ Wichtig sei daher, ein tiefgehendes Wissenschaftsverständnis in der Gesellschaft zu verankern, das nicht auf der Angst der Menschen fußt, sondern auf der Autorität der Wissenschaft. Unsicherheit und Ambiguität als Teil wissenschaftlicher Erkenntnisprozesse müssten in der schulischen Bildung, in den Medien, der Politik und in der Selbstdarstellung der Wissenschaft stärker thematisiert werden.
Die Frage aus dem Publikum, ob Wissenschaftskommunikation emotional werden müsse, beantwortet Rossmann mit Nein: „Denn dann verliert sie im Zweifelsfall an Autorität.“ Wissenschaft sei der Rationalität verpflichtet, Emotionalität dagegen sei Sache der Politik. Das sieht auch Bromme so: „Sowohl in der Berichterstattung über Wissenschaft als auch in der Berichterstattung aus der Wissenschaft können Sie eine Emotionalität zeigen, um Motiviertheit oder ein Engagement für das Thema deutlich zu machen. Aber keine Emotionalität einsetzen, wenn es um die Frage geht, ob eine Sachaussage stimmt oder nicht stimmt.“
Wissenschaftskommunikation als Teil der wissenschaftlichen Ausbildung?
In der Corona-Pandemie habe sich gezeigt, dass Wissenschaftskommunikation systemrelevant sei, sagt Moderator Daniel Lingenhöhl von Spektrum der Wissenschaft. „Bedeutet das, dass wir Wissenschaftskommunikation zum verpflichtenden Teil von Studiengängen machen sollten?“, fragt er die Diskutant*innen.
„Ich bin skeptisch gegenüber Pflichten, die man aus einer Krisensituation heraus entwickelt“, sagt Georg Schütte, Generalsekretär der VolkswagenStiftung. Wünschenswert sei aber, dass Wissenschaftskommunikation von der Wissenschaft stärker anerkannt und in Karriereverläufen besser honoriert werde. Corona habe gezeigt, dass Wissenschaftskommunikation nicht einfach nebenbei gehe. Rossmann hält dagegen: Für ihn gehöre Wissenschaftskommunikation als Grundqualifikation in jede wissenschaftliche Ausbildung. Die Ausgestaltung könne dann individuell sein.
Wichtig sei es, dass die Schulung in Wissenschaftskommunikation an der Universität nicht damit verwechselt werde, Medientrainings zu geben, findet Ziegler. Vielmehr müsse ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, welche Rolle öffentlicher Kommunikation in einer demokratischen Gesellschaft zukomme und welche Möglichkeiten es dafür in der wissenschaftlichen Ausbildung gebe. Auch müsse der Rahmen geschaffen werden, stärker darüber nachzudenken, welche Rolle Forschende gegenüber Politik und Gesellschaft haben. Dem schließt sich Bromme an: „Jede*r Wissenschaftler*in sollte verstehen, was ihre/seine Disziplin im Verhältnis zu den sonstigen kulturellen Deutungsangeboten zum Weltverständnis beiträgt. Die Reflexion dazu scheint in vielen Fächern ein Desiderat zu sein.“
Session
VolkswagenStiftung: Was wirkt? – Wissenschaftskommunikation in Corona-Zeiten
Dr. Georg Schütte ist Generalsekretär der VolkswagenStiftung. Zuvor war er Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung. Prof. Dr. Rainer Bromme ist Senior-Professor für Pädagogische Psychologie an der Universität Münster. Seit 2017 ist er Mitglied des wissenschaftlichen Beirats für das Wissenschaftsbarometer von Wissenschaft im Dialog. Dr. Ernst Dieter Rossmann ist Bundestagsabgeordneter für die SPD. Er ist Vorsitzender des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung. Ricarda Ziegler ist Referentin der Geschäftsführung von Wissenschaft im Dialog und Projektleiterin des Wissenschaftsbarometers. Daniel Lingenhöhl ist Chefredakteur bei Spektrum der Wissenschaft.
How to triage information Open Science während der Covid-19-Krise von Carla Romagna, Wissenschaft im Dialog
How to triage information Open Science während der Covid-19-Krise von Carla Romagna, Wissenschaft im Dialog

Eingeladen sind dafür der Wissenschaftler Emanuel Wyler, der am Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin an der Gensequenzierung von Virus-Infektionen forscht, und die Wissenschaftsjournalistin und stellvertretende Ressortleiterin Wissen bei der „WELT“, Wiebke Hollersen. Beide schildern zu Beginn ihre Eindrücke und persönlichen Erfahrungen bezüglich der aktuellen Entwicklungen in der Wissenschaftskommunikation: Für Emanuel Wyler ist es vor der Corona-Pandemie ausreichend gewesen, über Datenbanken wie PubMed und einen regen E-Mail-Austausch mit anderen Wissenschaftler*innen, die für ihn relevanten Informationen zu triagieren um ein Update der aktuellen Forschung zu erhalten. Insbesondere in letzter Zeit sei jedoch auch Twitter unglaublich wichtig geworden. Das Folgen von Wissenschaftler*innen weltweit, liefere nicht nur die neuesten Erkenntnisse und gebe Auskunft über veröffentlichte Papers, sondern helfe auch bei der Vorselektion von wichtigen Ergebnissen, erklärt Emanuel Wyler. Neben den Themen großer, wissenschaftlicher Magazine wie Nature, Science und Cell und anderer nichtfachlicher Medien und dem Interesse der Leser*innen, bieten auch die Trends auf Twitter der Wissenschaftsjournalistin Wiebke Hollersen Orientierung.
Das Anknüpfen an Trends scheint wichtig geworden zu sein, doch wer startet diese eigentlich? Hollersen meint, dass es oft prominente Wissenschaftler*innen seien, die viel kommunizieren, denn sie hätten eine große Reichweite und könnten den Fokus aufmerksamer Leser*innen auf neue Themen lenken. Dies habe sich seit der Covid-19-Krise stark verändert, denn zuvor wurde in den Wissenschaftsteilen der Zeitungen über Themen berichtet, die gerade latent aktuell seien,. Nun wird vieles von Corona dominiert, wodurch es weniger Vielfalt gebe.
Fear of missing out auch in der Wissenschaft ein Thema
Bekomme man durch die stetige Flut an neuen Informationen denn keine Angst, etwas Relevantes zu verpassen, fragt Luiza Bengtsson. Aus Sicht von Wiebke Hollersen hat die „fear of missing out“ in der Wissenschaftskommunikation seit der Corona Pandemie nicht nennenswert zugenommen. Ihr Fokus liege auf den Interessen der Leser*innen und was groß einschlägt, bekomme man sowieso mit. Es herrsche eher das Gefühl man verpasse interessante Inhalte aus anderen Bereichen.
Das sei ein interessanter Punkt, meint eine Stimme aus der Zuschauerschaft und eröffnet damit die Diskussion unter Einbeziehung des Publikums. Die Fishbowl-Diskussion ist ein interaktives Format. Die Teilnehmer*innen können sich am Gespräch beteiligen, indem „der freie Stuhl“ durch das Anschalten der eigenen Videoübertragung besetzt wird.
Neue Herausforderungen durch Fake News
Wie geht man gegen Fake News vor, interessiert das Publikum und inwiefern hat sich ihre Arbeit als Wissenschaftsjournalistin verändert in den vergangenen Monaten? Die Wertigkeit von Studien einzuschätzen sei auch für Wissenschaftsjournalisten mit Expertise nicht immer einfach, meint Wiebke Hollersen. Oftmals würde man sich gerne mit der Berichterstattung etwas zurückhalten, bis gesicherte und fundierte Informationen erhältlich sind. Jedoch sei der externe Druck manchmal zu groß, wenn ein Thema, ungeachtet seiner Relevanz oder Richtigkeit, schon viel Aufmerksamkeit erlangt hat. Es entstehe oft eine Folgedynamik, weswegen es besonders in Bezug auf die Corona-Pandemie für die Wissenschaftskommunikation wichtig sei, den Leser*innen auch immer den Entstehungsprozess einer Studie näher zu bringen.
Der Umgang mit falschen Informationen ist auch für die Wissenschaft nicht ganz einfach, meint Emanuel Wyler. Denn die Widerlegung von zweifelhaften Studien sei schwierig, zudem gebe es keine Lorbeeren für das Richtigstellen inkorrekter Informationen.
Open Science zur Veränderung von Machtstrukturen
Durch Open Science werden aktuelle Erkenntnisse aus der Wissenschaft heute schneller und einfacher zur Verfügung gestellt als früher. Durch die Covid-19-Krise hat sich dieser Trend noch verstärkt. Doch hat dies auch die Wissenschaftskommunikation erleichtert? Eine Teilnehmerin ist der Meinung, dass Wissenschaftskommunikator*innen in Zeiten von Open Science noch stärker darauf achten müssten, prozess- anstelle von ergebnisorientiert zu kommunizieren. Für die Wissenschaft sei Open Science weder gut noch schlecht, erklärt Emanuel Wyler. Natürlich sei die Transparenz dadurch größer und auch das Wegfallen von Paywalls großer Wissenschaftsmagazine sei eine positive Entwicklung, jedoch sei der Umgang und eine ethische Verhaltensweise der Wissenschaftler*innen viel entscheidender, denn der Wahrheitsgehalt müsse stets geprüft werden. Vor allem sei es aber wichtig, trotz der immensen Arbeit, welche Open Science noch mit sich bringt, diese auch als Chance zu nutzen, um Veränderungen in der aktuellen Machtstruktur zu bewirken.
Interaktives Format
How to triage information: Covid-19 and Open Science
Wiebke Hollersen ist Wissenschaftsjournalistin und stellvertretende Ressortleiterin des Bereichs Wissen bei der Welt und der Welt am Sonntag. Dr. Emanuel Wyler ist Wissenschaftler am Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in der Arbeitsgruppe für RNA Biologie und Posttranskriptionale Regulation. Dr. Luiza Bengtsson, arbeitet in der Wissenschaftskommunikation am Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin und in einem Europäischen Projekt zur Förderung von Open Science, dem ORION Open Science Project.
Social WallEinmischen erwünscht!
Forum Wissenschaftskommunikation DIGITALDas war das #fwk20 DIGITAL
#fwk21Save the Date
Wir sagen Danke
Wir danken allen Ausstellern, die das Experiment einer digitalen Ausstellung mit uns gewagt und sich im virtuellen Raum mit vielfältigen Angeboten präsentiert haben.
Wir danken allen Referent*innen und Moderator*innen für die spannenden Programmbeiträge und die große Bereitschaft und Flexibilität, die bereits geplanten Sessions, Workshops und Projektvorstellungen auch im Rahmen der digitalen Tagung engagiert und interaktiv umzusetzen.
Und nicht zuletzt danken wir ganz herzlich allen Teilnehmenden, die das Forum auch in diesem Jahr zum größten Branchentreff der Wissenschaftskommunikation im deutschsprachigen Raum gemacht haben.
Das Team hinter dem #fwk20 DIGITAL
Hella Grenzebach
Volontärin
Inge Fiedler
Online-Kommunikation
Dr. Ursula Resch-Esser
Sina Metz
Teilnehmendenanmeldung
Susanne Freimann
Melanie Herrmann
Assistenz
Hannah Günther
Daniela Unger
Ein ganz großes Dankeschön an alle Kolleg*innen von Wissenschaft im Dialog für Programmbeiträge und Moderationen, Video- und Insta-Live-Produktionen, Mozilla Hubs Gestaltung, Texte und Interviews sowie den engagierten Einsatz als Co-Moderator*innen und Zoom-Hosts beim Forum Wissenschaftskommunikation DIGITAL!
Sie haben Feedback, Anregungen oder Kritik zum #fwk20? Dann schreiben Sie uns an forum@w-i-d.de.















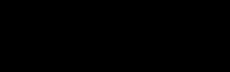












































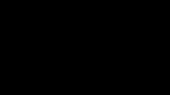































 #fwk20 im virtuellen Raum
#fwk20 im virtuellen Raum

 Einmischen erwünscht!?
Einmischen erwünscht!?
 „Verschwendet nicht zu viel Zeit auf die Leugner*innen“
„Verschwendet nicht zu viel Zeit auf die Leugner*innen“
 Was die Wissenschaft aus der Corona-Pandemie mitnimmt
Was die Wissenschaft aus der Corona-Pandemie mitnimmt
 Das waren die Projektvorstellungen beim #fwk20 DIGITAL
Das waren die Projektvorstellungen beim #fwk20 DIGITAL
 Partizipative Formate im Wissenschaftsjahr 2020|21 – Bioökonomie
Partizipative Formate im Wissenschaftsjahr 2020|21 – Bioökonomie
 Kommunikation und Forschungsmarketing – Einmischen erwünscht!
Kommunikation und Forschungsmarketing – Einmischen erwünscht!
 OpenD – OA-publizierte Dissertationen sichtbar und verständlich kommunizieren
OpenD – OA-publizierte Dissertationen sichtbar und verständlich kommunizieren
 Forschungsstrom – WissKomm mit Twitch
Forschungsstrom – WissKomm mit Twitch
 Wirkt es auf ihre Vertrauenswürdigkeit, wenn Wissenschaftler*innen sich politisch äußern?
Wirkt es auf ihre Vertrauenswürdigkeit, wenn Wissenschaftler*innen sich politisch äußern?
 Einmischen als Selbstmarketing: Wie Stiftungsprofessuren kommunizieren
Einmischen als Selbstmarketing: Wie Stiftungsprofessuren kommunizieren
 Themenschwerpunkt Wissenschaft & Politik
Themenschwerpunkt Wissenschaft & Politik
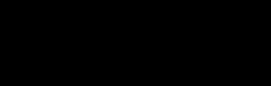 Themenschwerpunkt Wissenschaft & Politik
Themenschwerpunkt Wissenschaft & Politik
 Erst denken, dann handeln
Erst denken, dann handeln
 „Vielleicht wäre es besser, von Vorläufigkeit zu sprechen“
„Vielleicht wäre es besser, von Vorläufigkeit zu sprechen“
 Unsicherheiten kommunizieren lohnt sich
Unsicherheiten kommunizieren lohnt sich
 Expertise erwünscht?!
Expertise erwünscht?!
 Das waren die Projektvorstellungen aus Block 2
Das waren die Projektvorstellungen aus Block 2
 Gesundheitskommunikation in Rekordzeit - ein Krisenmanagement-Handbuch per Book Sprint bauen
Gesundheitskommunikation in Rekordzeit - ein Krisenmanagement-Handbuch per Book Sprint bauen
 Brake the fake: Wie ein neuer Newsroom in der Klimakommunikation mitspielen will – und warum
Brake the fake: Wie ein neuer Newsroom in der Klimakommunikation mitspielen will – und warum
 Eine „Teestunde mit Forschenden“ in der Seniorenresidenz
Eine „Teestunde mit Forschenden“ in der Seniorenresidenz
 Bauhaus.MobilityLab – Wissenschaftskommunikation im Reallabor
Bauhaus.MobilityLab – Wissenschaftskommunikation im Reallabor
 Welche Auswirkungen hat Citizen Science auf unsere Gesellschaft?
Welche Auswirkungen hat Citizen Science auf unsere Gesellschaft?
 Wissenschaftskommunikation evaluieren: Stand der Praxis im deutschsprachigen Raum
Wissenschaftskommunikation evaluieren: Stand der Praxis im deutschsprachigen Raum
 Live-Recaps des #fwk20 zum Nachschauen
Live-Recaps des #fwk20 zum Nachschauen
 „Wir müssen Daten und Zahlen verantwortungsvoll kommunizieren“
„Wir müssen Daten und Zahlen verantwortungsvoll kommunizieren“
 Vertrauen in Wissenschaft und Forschung in Corona-Zeiten
Vertrauen in Wissenschaft und Forschung in Corona-Zeiten
 Das waren die Projektvorstellungen aus Block 3
Das waren die Projektvorstellungen aus Block 3
 Belastbare Zahlen für wissenschaftspolitische Debatten
Belastbare Zahlen für wissenschaftspolitische Debatten
 Online-Plattform für Wirkung und Evaluation in der Wissenschaftskommunikation
Online-Plattform für Wirkung und Evaluation in der Wissenschaftskommunikation
 Das Format „Faktencheck“ als Basis für politische Dialoge
Das Format „Faktencheck“ als Basis für politische Dialoge
 Wissenschaftskommunikation in der Krise: Der Corona-Blog des WZB
Wissenschaftskommunikation in der Krise: Der Corona-Blog des WZB
 Digitalen Wandel aktiv gestalten? Wissenschaftskommunikation in der Digitalisierungsforschung
Digitalen Wandel aktiv gestalten? Wissenschaftskommunikation in der Digitalisierungsforschung
 Technikhype oder Alternative im Alltag? Einstellungsforschung zu Lieferdrohnen und Flugtaxis
Technikhype oder Alternative im Alltag? Einstellungsforschung zu Lieferdrohnen und Flugtaxis
 Vorsicht vor einfachen Schlussfolgerungen
Vorsicht vor einfachen Schlussfolgerungen
 Open Science während der Covid-19-Krise
Open Science während der Covid-19-Krise
 Einmischen erwünscht!
Einmischen erwünscht!
 #fwk20-Playlist zum Nachschauen
#fwk20-Playlist zum Nachschauen
 #fwk20-Playlist zum Nachschauen
#fwk20-Playlist zum Nachschauen
 Das war das #fwk20 DIGITAL
Das war das #fwk20 DIGITAL
 Save the Date
Save the Date
 Wir sagen Danke
Wir sagen Danke
 Dank an Förderer, lokale Partner, Unterstützer und Aussteller
Dank an Förderer, lokale Partner, Unterstützer und Aussteller
 Das Team hinter dem #fwk20 DIGITAL
Das Team hinter dem #fwk20 DIGITAL